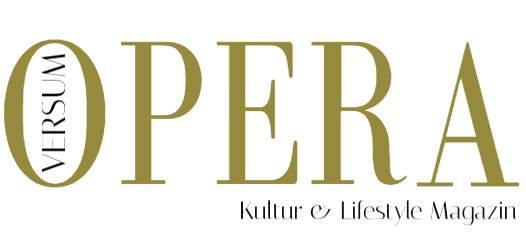
Salzburger Festspiele: Maria Stuarda oder die Bewegung als Beschreibung des Seins!
28. Juli 2025
Rubrik News

© SF/Neumayr/Leo
Seit mehreren Wochen laufen die Proben zur diesjährigen Neuinszenierung von Donizettis Maria Stuarda. Weniger die Liebesgeschichte als vielmehr ein „elementarer Machtkampf im Spannungsfeld von Existenzbedrohung, Manipulation und Reibungen“ steht für Regisseur Ulrich Rasche im Mittelpunkt des Werks.
Das Bühnenbild komme im Großen Festspielhaus in seinem „vollen, monumentalen Ausmaß“ zur Geltung. Mittels einem auf mechanische Drehscheiben reduzierten Bühnenraum lasse sich die ganze Brutalität dieser Konflikte darstellen.
Nicht die Königinnen allein sind es dabei, die die Mechanismen der Macht antreiben, vielmehr auch die Personen, die sie manipulativ umgeben – hier repräsentiert durch eine Gruppe individuell gecasteter Tänzer der SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance).
„Beide Frauen sind nicht nur mächtig, sondern gleichzeitig auch ohnmächtig“, sagt Rasche, für den das Stück in gewisser Weise auch ein Abbild der heutigen Gesellschaft ist, in der es oftmals Individuen gebe, die von außen abhängige, getriebene Opfer seien.

©SF / Monika Rittershaus

©SF / Monika Rittershaus
Nicht im Widerspruch zur großen musikalischen Besetzung sieht Dirigent Antonello Manacorda Rasches vergleichsweise reduziertes Regiekonzept:
„Ich sehe hier gar keinen Kontrast. Seine Art, zu arbeiten kommt uns entgegen. Die musikalische Anlage von Donizettis Werk mit seinen breit gefächerten Facetten des Operngesangs lässt sich gut daran anpassen.
Für mich ist das Ganze so, wie man Oper machen sollte – in dieser Zusammenarbeit entsteht echtes Musiktheater.“
Die Titelpartie singt Lisette Oropesa. Über die Gegensätze und Gemeinsamkeiten der beiden Königinnen sagt sie: „Ich betrachte Maria als reale historische Person, ihre Darstellung geht über das tatsächliche Belcanto hinaus. Ich versuche beim Anlegen der Rolle, die Tragik und das Leid, das sie erfahren hat, herauszuarbeiten.
Und gleichzeitig können wir daraus die Frage ableiten: Was haben wir von der menschlichen Seite her daraus gelernt? Maria fasziniert uns nicht nur unter dem Aspekt der Tragödie, sondern berührt unsere Herzen auch durch ihre Aufrichtigkeit und ihren unerschütterlichen Glauben.
Das zeigt sich besonders in ihrem Gebet kurz vor ihrer Hinrichtung. Das ist beinahe ein kirchlicher Hymnus, der all das symbolisiert, wofür Religion steht.“

© SF/Neumayr/Leo
Und Kate Lindsey sagt über ihre Rolle der Elisabetta: „Maria und Elisabetta könnten eigentlich gute Freundinnen sein – wäre da nicht der Machtkonflikt zwischen ihnen.
Vielleicht wird Elisabetta in der Oper zu wenig als Führungspersönlichkeit verstanden – aus meiner Sicht muss man zwischen der Opernfigur und der echten Elisabeth unterscheiden, die im Vergleich zu Maria keine sie unterstützende Gefolgschaft und liebenden Menschen um sich herumhatte.
Ich denke, dieses Defizit versucht sie dadurch zu kompensieren, dass sie eine schwesterliche Beziehung zu Maria sucht. Für die ihr auferlegte Bürde, die politischen Machtspiele und die fortwährende Bewegung ist Ulrich Rasches Maschinerie ein treffendes Sinnbild.“
Über seinen Umgang mit Bewegung in seiner Arbeit unter Vorgabe einer konkreten Partitur sagt Rasche: „Die persönlichen Annäherungen der Figuren stehen in keinem Widerspruch zur Maschinerie, sondern finden zu einem Einklang.
Die Herausforderung, die wunderschönen Stimmen in einen Kontrast zum Drama zu setzen, geht gut auf.“ Ergänzend illustriert werde das auch durch choreografische Elemente. Über die Fähigkeiten der beiden Hauptdarstellerinnen, sich parallel zum Gesang tänzerisch auf den rotierenden Scheiben zu bewegen, sei er sehr glücklich.
Die konkreten Schrittfolgen habe man im Vorfeld anhand des Notentextes erarbeitet. „Es entsteht dadurch eine Synthese aus Bewegung, Gesang und Maschinerie.“
Lisette Oropesas Darstellungsverständnis kommt dieser Ansatz ohnehin entgegen: „Als Sängerin arbeite ich mit ganzem Körpereinsatz. Die Arbeit ist eine 360 Grad-Erfahrung: durch die konstante, von Bewegung getragene Anspannung fühle ich mich uneingeschränkt frei und kann unwesentliche Dinge besser ausblenden – das ist eine wunderbare Erfahrung.“

© SF/Neumayr/Leo
Die Einbeziehung von Bewegungselementen in den Gesang empfindet auch Manacorda als bereichernd: „Die Auseinandersetzung mit der Landkarte der Schritte hat sich im Lauf der Proben intensiviert.
Für mich hat der Faktor Zeit in der Musik schon immer eine große Rolle gespielt – Bewegung als Beschreibung des Seins. Wir haben versucht, jede Bewegung der Sänger nicht als Beschränkung, sondern als Amplifizierung des Ausdrucks zu sehen. Auch dank der Bewegung und tänzerischen Interaktion entdeckt man in der Partitur jeden Tag Neues.“
Und auch Kate Lindsey stimmt zu: „Das Singen ist sowieso mit einer Vorwärtsbewegung vergleichbar. Was ich durch die Proben auch gelernt habe, ist, dass man den körperlichen Aspekt nicht ignorieren sollte. Dabei hat uns auch ein kontinuierlicher Dialog über Geschwindigkeit geholfen:
Wenn man sich einen Rhythmus aneignet, entsteht so etwas wie ein innerer Puls. Der Rhythmus unterstützt die Figuren darin, sich selbst über die nächsten Schritte im Klaren werden. Es entsteht eine Verbindung von Körper und Geist.“
An der Begegnung und dem konstruktiven Umgang mit solchen physischen Herausforderungen sei sie auch schon im Rahmen ihrer ersten Mitwirkung bei einer Festspielproduktion, Jan Lauwers´ Inszenierung von Monteverdis L´incoronazione di Poppea im Jahr 2018, mit Blick auf ihre Karriere gewachsen.

©SF / Monika Rittershaus
Mit Begeisterung erinnert sich auch Oropesa an ihren letztjährigen Salzburger Auftritt in der konzertanten Aufführung von Lucia di Lammermoor:
„Hierher würde ich jederzeit sofort wieder zurückkommen. Die Stadt, die Atmosphäre und die Art, hier zu proben, ist wunderbar.“ Obwohl sie als Maria Stuarda erst kürzlich debütiert habe, fühle sich die Rolle fast schon als ein Teil von ihr an. Über die Unterschiede zwischen konzertanten und szenischen Aufführungen sagt sie:
„Bei Meisterwerken wie diesen funktioniert beides. Eine gemeinsame szenische Erarbeitung mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen wie hier setzt aber nochmal zusätzliche Energien frei.“ Und Oper, so sagt sie, sei letztlich die einzige Kunstform, die Aspekte aus Film, Theater, Tanz und Musik zusammenführe – „etwas, das alle Sinne umgibt“.
Dass dabei alle auf einer künstlerischen Wellenlänge liegen, betont auch Manacorda: „Die Lösungen für die sängerischen, physischen und darstellerischen Herausforderungen, formen wir alle gemeinsam“.
Quelle: Presse Salzburger Festspiele
